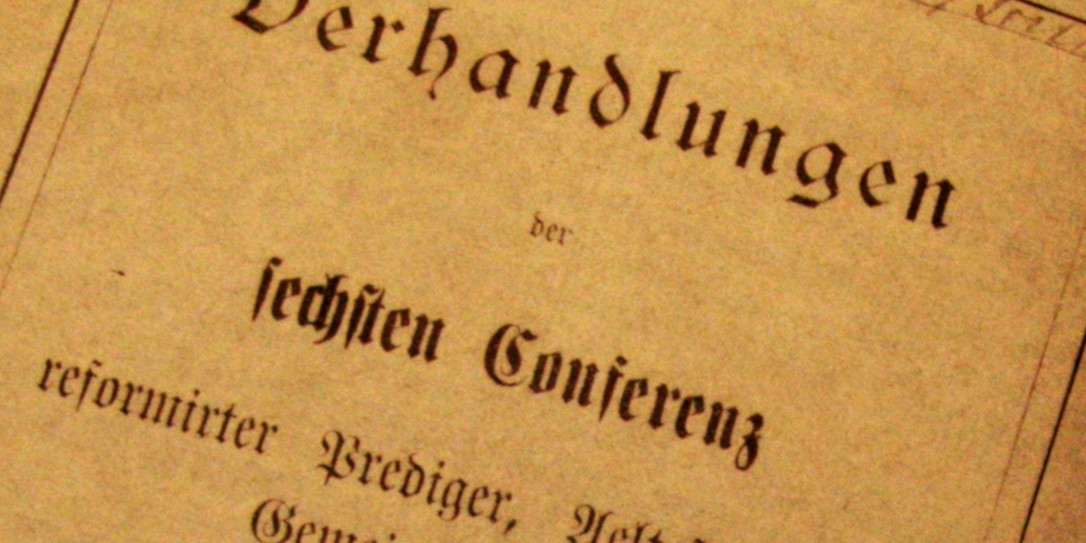Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Calvinismus und Kapitalismus
Anmerkungen zur Prädestinationslehre Calvins

Dass irgend ein Zusammenhang bestehe zwischen Kapitalismus und Calvinismus und dass dieser Zusammenhang mit der Prädestinationslehre zu tun habe, ist eine so verbreitete Meinung, dass es lohnt, sie auf einem Calvin-Symposion einmal zu thematisieren. Eine Kurzfassung der verbreiteten Meinung kann ich mit einem Zitat wiedergeben, das mir in einem Vorbereitungsbüchlein für den evangelischen Kirchentag 1989 begegnet ist: »Bekanntlich hat Calvin wirtschaftlichen Erfolg als Maßstab dafür angesehen, ob ein Mensch von Gott erwählt ist. Die Folgen haben wir bis heute zu tragen.« (1)
Wenn jemand »bekanntlich« sagt, darf man annehmen, dass er nicht nach Genauerem gefragt werden möchte. Wollte man doch danach fragen, käme schnell heraus, wie haltlos eine solche Behauptung über Calvin ist. Nicht viel besser steht es um die Fortsetzung: »Die Folgen haben wir bis heute zu tragen«. Wieso soll, dass Calvin eine Ansicht hatte – einmal angenommen, er hätte sie wirklich gehabt –, Folgen bis zu uns heute zeitigen? Hier fehlen alle historischen Zwischenglieder, die erkennen ließen, wie aus einer (vermeintlichen) Ansicht Calvins weltgeschichtlich wirksame Folgen entstanden sein mögen. Auch das wird offensichtlich als bekannt vorausgesetzt.
Was da als bekannt vorausgesetzt wird, dürfte die sog. Max-Weber-These sein, die zurückgeht auf Webers Aufsätze »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« aus den Jahren 1904/05, mit dem Nachtrag »Kirchen und Sekten« aus dem Jahre 1906. Weber hat diese Aufsätze 1920 neu herausgegeben im 1. Band seiner Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie – überarbeitet und bereichert durch allerlei Auseinandersetzungen, zudem hineingestellt in einen neuen Fragezusammenhang. (2)
Doch man muss unterscheiden zwischen dem, was Max Weber geschrieben hat, und dem, was daraus in der Rezeptionsgeschichte geworden ist. Um erst einmal Weber in Schutz zu nehmen: Dass Calvin wirtschaftlichen Erfolg als Maßstab dafür angesehen hätte, ob ein Mensch von Gott erwählt ist, hat Weber nirgendwo behauptet. Er hat in seinen genannten Abhandlungen auch von niemand anderem behauptet, dass er eine solche Meinung vertreten habe. Erst nachträglich stieß er zu Formulierungen vor, die diese Ansicht allenfalls nahelegen könnten (3), und dann hat sie sich im Zuge der Rezeption Webers durchgesetzt.
Ich versuche zu Beginn eine kritische Darstellung der sog. Max-Weber-These, gehe dann zu ihrer Befragung über und lenke von dort zurück zu Calvins Prädestinationslehre – nun in Barths Darstellung von 1922.
I.
Ein Teil der populären Wirkung von Webers Aufsätzen dürfte von den attraktiven Begriffen kommen, die er gewählt hat. Ich vermute allerdings, dass ihre Attraktivität nicht zuletzt darauf beruht, dass sie etwas Populistisches an sich tragen.
1. Nehmen wir gleich den Leitbegriff »Geist des Kapitalismus«! Was hierbei mit »Geist« gemeint ist, nennt man heute »Mentalität«; es ist Gegenstand der Mentalitätsforschung geworden. Max Weber hatte sich vorgenommen, die Herkunft derjenigen menschlichen Mentalität darzustellen, die zu Entstehung und Siegeszug des Wirtschaftssystems des Kapitalismus beigetragen hat. Ihre entscheidende Herkunft sah er in der calvinistisch beeinflussten Frömmigkeit, wobei er zunehmend deutlicher zugab, damit nur eine unter vielen Entstehungsbedingungen der kapitalistischen Mentalität und erst recht des Kapitalismus als Wirtschaftsform herausgegriffen zu haben. Indem er für die aus dem Calvinismus hervorgegangene Mentalität den Ausdruck »Geist des Kapitalismus« wählte, suggerierte er aber nun doch, dass hier die schöpferische Kraft zum Kapitalismus hin gelegen habe. Und er suggerierte zudem, dass der Kapitalismus einen »Geist« habe... Für uns ist nur wichtig, sich bewusst zu halten, dass Weber mit diesem Begriff eine dem Kapitalismus förderliche, zumindest angemessene Mentalität thematisieren wollte.
2. Eine andere populär gewordene Webersche Begriffsbildung lautet »innerweltliche Askese«. Gemeint ist dabei: Askese in und durch den Beruf. Dies sei protestantisches Ethos gewesen. Damit hat Weber der Sache nach etwas Richtiges herausgestellt, aber der Begriff »innerweltliche Askese« ist besinnungslos, denn schließlich ist alle Askese innerweltlich. Ob es außerhalb der Welt Askese gibt, dürfte keine sinnvolle Frage sein. Trotzdem gebraucht Weber auch den Gegenbegriff »außerweltliche Askese«. (4) Damit meint er mönchische, klösterliche Lebensformen. Fragt man, inwiefern diese »außerweltlich« seien, so erfährt man nur, dass sie sich außerhalb des „Berufslebens“ im modernen Sinne vollziehen. Damit stehen wir vor einer bloßen Tautologie.
Zudem passt zu dieser Bestimmung nicht, dass nach Weber der Berufsbegriff erst mit der Reformation wichtig geworden sei, so dass zumindest das mönchische Leben vor der Zeit der Reformation nicht anhand des Berufsbegriffs definiert werden kann, auch nicht zur Abgrenzung oder Unterscheidung. Doch über derartige Kleinigkeiten ist Weber bei seinem Gebrauch von »innerweltlich / außerweltlich« erhaben. – Schließlich wird man auch zu bedenken geben müssen, dass es schon im Blick auf ihre geschichtlichen Funktionen kaum angeht, Klöster als »außerweltlich« zu bezeichnen – berücksichtigt man, was diese im Abendland oft genug für die Lebensgestaltung, für Kultur und Versorgung der Gesellschaft – also »innerweltlich« – bedeutet haben.
Gewiss ist es auch historisch unumgänglich, einen Unterschied zu machen zwischen Klosterleben und nicht-klösterlichem Leben. Nur sollten dazu die angemessenen Begriffe gesucht werden. Theologisch ist das möglich und auch geschehen. Da Max Weber in den hier zur Debatte stehenden Untersuchungen die protestantische Ansicht durch die Westminster-Confession von 1647 artikuliert sieht, will ich dies Dokument auch für diese Frage sprechen lassen. Cap. XVI, »Von den guten Werken« (De bonis operibus / Of Good Works), beginnt so: »Gute Werke sind nur solche, die Gott in seinem heiligen Wort angeordnet hat (praecepit / hath commandeth), nicht aber solche, die ohne seine Autorisierung von Menschen ersonnen sind, sei es aus blindem Eifer oder unter irgendeinem Vorwand der guten Absicht.« (5) Reformatorische Theologie unterschied also zwischen gottverordneten Taten und selbsterdachten Taten, ebenso zwischen gottgeordneten Institutionen und bloß von Menschen ersonnenen Institutionen. Auf Grund der Bibel galten ihr Mönch- oder Nonne-Werden als selbstersonnene Taten und deshalb als nicht gut, mag der Eifer dabei auch noch so gut gemeint sein; und Klöster galten ihr als von Menschen erfunden und nicht von Gott geboten und deshalb verwerflich – im Unterschied zu »Ständen« wie dem des Bauern oder des Kaufmanns oder Fürsten, oder im Unterschied zum »Stand« der Ehe. (6)
Nun kann man mit der Alternative von Gottes Gebot und Menschenfündlein sozialwissenschaftlich natürlich nicht arbeiten. Aber mit dem Begriffspaar »innerweltlich / außerweltlich« auch nicht. Dass es sozialwissenschaftlich ernst genommen und unablässig ernsthaft kolportiert wird, mag seinen Grund darin haben, dass im Selbstverständnis von uns Menschen der modernen industriellen Lebenswelt Klöster als unproduktiv gelten. Mönchische Askese gehört nicht zur bürgerlichen Welt, also nennt man sie flott »außerweltlich«. Die Karriere des Begriffspaares »innerweltlich / außerweltlich« beruht meiner Meinung nach auf einer vordergründigen modernen Plausibilität.
Es sei aber unterstrichen, dass Weber durchaus auf etwas Richtiges hingewiesen hat, das allerdings schon vor ihm in den Überlegungen zur Geschichte der Neuzeit immer präsent war und das man historisch auch nicht zu hoch bewerten sollte: dass nämlich die Reformation – indem sie jede Tätigkeit, die sich theologisch auf Gottes Anordnung zurückführen ließ, als Gottesdienst einstufte – eine Aufwertung der Berufsarbeit, ja fast jeder Arbeit gebracht hat. Und das Verständnis der Arbeit im Dienst der Mitmenschen als Gottesdienst bedeutete in der Tat, dass die Arbeit asketisch, das heißt: mit der ständigen Bereitschaft zu Verzicht und Entsagung, zu tun sei – nicht nur gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Ebenso wie die Reformation das Priestertum aller Gläubigen proklamiert hatte, wollte sie auch die Intensität des Klosterlebens gleichsam zum christlichen Normalleben machen. Luther hat sogar noch eins draufgegeben, indem er erklärte, dass die von Gott gesetzten Berufe mehr Askese verlangen, als im Kloster üblich ist. Um die Entsagung, die es beispielsweise erfordert, eine Schar Kinder aufzuziehen, – um diese Entsagung zu meiden, deshalb gingen nach Luthers Meinung viele ins Kloster. (7) Das sollte man berücksichtigen.
Aber nicht alle Berufe und Arbeiten galten den Reformationskirchen als Gottesdienst. Die Grenze war erreicht, wenn Berufe gegen Gottes Gebote und gegen den Nächsten gehen. Deshalb findet sich in der protestantischen Literatur (im Einklang mit der kirchlichen Tradition) die hartnäckige Bekämpfung des Wucherhandels. Mit der Verwerfung des Wucherhandels entsteht nun für die von Weber bevorzugte Linie von »der protestantischen Ethik« zum »Geist des Kapitalismus« ein schwieriges Hindernis, das Weber aus dem Wege räumen zu können meinte, indem er immer wieder den Wucher als untypisch für den neuzeitlichen abendländischen Kapitalismus erklärte. Dessen adäquate Wirtschaftsgesinnung, die seinen »Geist« ausmache und der er sich auch irgendwie verdanke, sei vielmehr die des rechtschaffenen Berufseifers.
II.
Man stutzt bei solcher Beschreibung des »Geistes des Kapitalismus«. Ich lasse das aber auf sich beruhen, weil es mir um die von Weber vorgetragene Darstellung der protestantischen Ethik geht. Dafür genügte ihm nun der Verweis auf die reformatorische Berufsauffassung nicht, und zwar deshalb nicht, weil diese von Luther ausgeht und im deutschen Luthertum heimisch geworden ist, die Entstehung des neuzeitlichen Kapitalismus aber nicht in Deutschland und auch nicht in außerdeutschen lutherischen Gebieten vonstatten ging. Weber musste also noch ein spezifisches Moment des nicht-lutherischen Protestantismus präsentieren, das der lutherischen Berufsauffassung erst die besondere Note gegeben habe, die zum »Geist des Kapitalismus« führen konnte. Diese besondere Note sah er veranlasst durch die Prädestinationslehre Calvins, wie sie in den reformierten Kirchen, besonders in den Niederlanden und im englischen Puritanismus, gepflegt wurde und von dort in das Bewusstsein einiger einflussreicher nordamerikanischer protestantischer Denominationen eingegangen ist.
Fragt man, was an der Prädestinationslehre besonderen Einfluss auf die Berufsethik gehabt habe, so kann man das nach Weber nicht an dem ausmachen, was an dogmatischen Problemen den reformierten Protestantismus beschäftigt und in viel Streit geführt hat. Vielmehr war nach Weber an der Prädestinationslehre ethisch wirksam, was im Calvinismus nie strittig gewesen sei: nämlich dass derjenige, der sich zum Heil prädestiniert wissen will, diese Erwählung in seiner Lebensführung bewähren soll.
»Bewährung« ist das Stichwort, das Weber unablässig wiederholt zur Charakterisierung der spezifischen Eigenart der calvinistisch-puritanischen Lebensprägung durch die Prädestinationslehre. Der Leser ist auf die Dauer bereit, das zu glauben, zumal Weber Zitate von Luther oder lutherischen oder auch katholischen Theologen bringt, um zu belegen, dass dort überall der calvinistisch-puritanische Gedanke der Bewährung fehlt. Nur: Er bringt keinen Beleg für den Gedanken der Bewährung und keinen, der den Begriff enthält, nicht einmal eine Erwägung über die sprachlichen Äquivalente im Lateinischen und Englischen – und das nicht zufällig. Der Begriff »Bewährung« (auf die sprachliche Seite komme ich gleich) ist im Calvinismus nämlich genauso irrelevant wie sonst in der Theologie. Ich habe trotz eifrigen Suchens und Nachschlagens nichts gefunden, wo dieses Wort eine markante oder markierende theologisch-ethische Rolle gespielt hätte. Wir stehen also vor der schwierigen Situation, dass Weber unter hartnäckiger, häufig sogar gesperrt gedruckter Verwendung des Wortes »Bewährung« etwas darstellen will, wofür die Dargestellten selber das Wort »Bewährung« nicht gebraucht haben.
Was meint Weber mit »Bewährung«? Er geht davon aus, dass die Prädestinationslehre den Einzelnen in die innere Isolierung und dabei in die furchtbare Ungewissheit gestürzt habe, nicht zu wissen, ob er erwählt ist oder ob er zu den von Gott Verworfenen gehört. Kultische Vergewisserung sei ihm verwehrt gewesen, weil der Calvinismus die Sakramente »entzaubert« und die Beichte abgeschafft hat. Auch das innere Glaubenserlebnis habe im Calvinismus nicht zur Vergewisserung dienen dürfen, sondern nur die praktische Tätigkeit im Beruf. Und diese sollte streng unter Vermeidung aller »Kreaturvergötzung« geschehen, will sagen: ohne sich von eigenem Nutzen oder mitmenschlichen Freuden oder von der Frage nach der für den Nächsten nützlichen Zweckmäßigkeit der Tätigkeit leiten zu lassen. Die Lebensführung systematisch dem Beruf an sich unterzuordnen – das sei die Bewährung, in der der verunsicherte Gläubige seines Erwähltseins durch Gott gewiss werde.
Man sieht: Es wird von Max Weber eine Anzahl verschiedener Elemente zusammengetragen, um das aufzubauen, was er »Bewährung der Erwählung« im calvinistisch geprägten Puritanismus nennt und was seiner Meinung nach mit zum »Geist des Kapitalismus« geführt habe. Letztlich sei es der stetige und methodische Berufseifer als solcher gewesen, durch den der Fromme sich seiner Erwählung zum ewigen Heil versichern hat wollen. Diese Einstellung ist für Weber etwas höchst Irrationales, das aber durchaus rationale Momente entbunden habe, indem dadurch das Berufsleben durchgestaltet und das ganze Leben auf den Beruf hin dressiert wurde. Solche Gläubigen werden im Geschäftsleben berechenbar: als unermüdliche und ehrliche Berufsarbeiter; und wenn sie mit Geld zu tun haben, so werden sie unermüdlich und ehrlich Geld scheffeln – nicht um »davon etwas zu haben«, sondern ganz »asketisch« um des Bewährungs-Eifers des Geld-Scheffelns als solchem willen. Sie werden das Geld nicht zum Lebensgenuss ausgeben, sondern im Berufseifer als Kapital anlegen zur weiteren Geldvermehrung als solcher. So wird für sie das Gewinnmachen geradezu zum sittlichen Beruf, der die Notwendigkeit stets steigender Geldbeschaffung in sich birgt.
Versucht man, Weber hier möglichst korrekt darzustellen, so überkommt einen sehr schnell ein gewisses Unbehagen, weil das Konstrukt einen reichlich unwahrscheinlichen Eindruck macht und voller Gedankensprünge ist. Schon deshalb hat sich im Zuge seiner Rezeption eine vereinfachte Fassung herausgebildet und durchgesetzt. Die besagt eben, dass die calvinistischen Frommen sich ihre Erwählung durch wirtschaftlichen Erfolg im Geschäftsleben bestätigen zu müssen glaubten. Und damit meint man auch, den direkten Übergang zu dem, was man sich unter dem »Geist des Kapitalismus« vorstellt, vor Augen zu bekommen. Doch so vereinfacht hat Weber dies nicht vorgetragen.
Man muss sich Webers Vorgehen klarmachen: Er kommt nicht von der Vergangenheit der »protestantischen Ethik« aus zum »Geist des modernen Kapitalismus«, sondern umgekehrt von einer Bestimmung des »Geistes des Kapitalismus« zur Behauptung von dessen religiösen Wurzeln (wie er sich ausdrückt). Ein solches Vorgehen ist an sich nicht unberechtigt. Das Problem liegt jedoch darin, wie der Ausgangspunkt, von dem aus man zurückfragen will, bestimmt wird, wie es zu seiner Definition kommt und wie diese sich ausweisen kann. Und gerade an dieser Stelle verweigerte sich Weber jedem Problembewusstsein. Der Volkswissenschaftler Lujo Brentano hatte gleich geurteilt, dass Webers Begriff des »Geistes des Kapitalismus« schon als Voraussetzung in sich enthalte, was erst bewiesen werden sollte. Dieses Urteil erklärte Weber für eine ihm »unverständliche Behauptung«. (8) Anstatt sich also zu einer genaueren Prüfung und Klärung der Ausgangsbestimmung veranlasst zu sehen, stellte sich Weber taub. Vermutlich hat er Brentanos Einwand nur zu gut verstanden.
Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, dass Weber sich nicht bewusst gewesen sein sollte, dass die Ausgangsbestimmung von ihm so gefasst ist, dass sie alles weitere der angeblich rein historischen Untersuchung schon in sich trägt bzw. notwendig nach sich zieht: Wenn der »Geist des Kapitalismus« einen irrationalen Habitus des Sparens und Geld-erwerben-Müssens darstellt, ohne dass der Träger dieses Habitus’ davon Nutzen und Annehmlichkeiten erwartet, so gibt es auf die Frage, woher solch selbstloser innerer Zwang kommen mag, nur die eine Antwort: aus der Religion. Denn dass Religion zwanghafte Charaktere produziert und zu irrationalem Eifer antreibt, das »weiß« man schließlich. Diese Erklärung ergibt sich unausweichlich, wenn vorweg aus dem »Geist des Kapitalismus« per definitionem aller Wille zur materiellen Selbstbereicherung ausgeschlossen worden ist. Spätere Rezipienten haben Weber seine Bestimmung des »Geistes des Kapitalismus« denn auch nicht geglaubt und haben sich wohl auch deshalb die Calvinisten so vorgestellt, dass sie wirtschaftlichen Erfolg gesucht hätten zur Bestätigung ihrer göttlichen Erwählung.
Es wird von Weber also eine willkürliche Definition an den Anfang gestellt – und aus dieser Definition wird die Historie herauskonstruiert. In welchem Ausmaß das geschieht, macht eine Schilderung deutlich, die Weber in seiner ersten Abhandlung von dem durch solchen »Geist« verursachten wirtschaftlichen Umbruch gibt. (9) Danach herrschte in der kontinentalen Textilbranche bis ins 18. Jahrhundert hinein ein »gemächliches« Leben. Weber spricht von »Behaglichkeit« und »Idylle«, auch von »bequemem Lebensgenuss«. Wie idyllisch er sich diese Zustände vorstellte, sieht man an der Bemerkung: »im ganzen relativ große Verträglichkeit der Konkurrenten untereinander«. Auch wird die Ausgangslage so dargestellt, als ob alle bei maßvoller Arbeitsanforderung ein erträgliches Auskommen gehabt hätten. Dahinein brach dann oft genug »irgendein junger Mann« ein, der – ohne dass ein materieller Grund dazu bestanden hätte! – einen neuen »Geist« in das Wirtschaften brachte, der rein um der guten Berufserfüllung willen Bauern »zu Arbeitern erzog« und »ihre Abhängigkeit und Kontrolle zunehmend verschärfte« und das Produktionsprinzip »billiger Preis, großer Umsatz« durchzuführen begann. Von da ab und dadurch war die Folge: »wer nicht hinaufstieg, musste hinabsteigen«.
III.
Ich kann jetzt nicht weiter auf Grundanschauungen Webers eingehen, auch nicht auf die mit seinen Untersuchungen verknüpften Interessen; dazu müsste auch seine Beeinflussung durch Nietzsche berücksichtigt werden. (10) Ich wende mich gleich der für unser Symposion wichtigen Frage zu, wieweit sich Webers Bild vom calvinistischen Prädestinations-Ethos historisch rechtfertigen lässt; denn Weber beansprucht, eine »rein historische Darstellung« gegeben zu haben, sogar (man höre und staune) »streng empirische Studien«. (11) Damit provoziert er zwangsläufig die Frage: Hält sein Unternehmen einer historischen Überprüfung stand? Die Antwort kann m.E. nur sein: Es lässt sich gar nicht überprüfen; denn man weiß nicht, woran man es messen soll. Ja, man weiß nicht einmal, was es besagt.
1. Ich bleibe zunächst bei letzterem: Man bekommt nicht heraus, was Weber sagen will. Geht man vom »Geist des Kapitalismus« aus, wie Weber ihn zu definieren beliebte, so besagt seine »These«, dass dieser »Geist« eine Frucht calvinistisch-puritanischer Frömmigkeit sei. Hier benutzt er Ausdrücke einer Kausalverbindung: Das Modernere (der »Geist des Kapitalismus«) lässt sich aus dem Älteren (aus der calvinistischen Berufsethik) »erklären«, hat darin seine »religiösen Wurzeln«, seine »ideelle Grundlage«, »entstammt« daraus, ist deren »Wirkung«, gehört zu deren »Folgen«. So Webers Ausdrücke. (12) In der Geburts-Metaphorik, die wohl durch Nietzsche nahegelegt war, kann es dann abschließend heißen: »Die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee (13) ist – das sollten diese Darlegungen erweisen – geboren aus dem Geist der christlichen Askese«. (14) »Geboren aus« (natus ex) – danach wäre die puritanische Ethik Mutter des »Geistes des Kapitalismus«. Das meinte Weber »erwiesen« zu haben, und der Leser scheint vor einem klaren Ergebnis zu stehen (– wenn er auch nicht erfährt, wer der Vater ist).
Andererseits wehrt sich Weber dagegen, dass dies sein Ergebnis sei, ja dass er solch direktes Abstammungsverhältnis auch nur im Auge gehabt habe. (15) Und das bekräftigt er dadurch, dass er sich an anderen Stellen ganz anders ausdrückt. So findet sich am Ende des ersten Aufsatzes die Formulierung, zwischen der puritanischen Frömmigkeit und dem »Geist des Kapitalismus« hätten »bestimmte Wahlverwandtschaften« bestanden, (16) wobei das Wort »Wahlverwandtschaften« in Anführungsstriche gesetzt ist. Man kann sich denken warum – nur: »Wahlverwandtschaft« setzt voraus, dass beide Seiten für sich existieren und dann erst – durch die Chemie der Gefühle – zueinander finden. (Ein ähnliches Verhältnis wird unterstellt, wenn es öfter heißt, eines sei dem anderen »adäquat« gewesen.) Das ist eine ganz andere Beziehung als die kausale, wobei der Plural »Wahlverwandtschaften« – aus Goethes Romantitel unverändert übernommen – in diesem Fall noch weiterer Verunklarung dient. In der Auseinandersetzung mit Felix Rachfahl hat Weber den Ausdruck wiederholt, aber nun ohne Anführungsstriche und im Singular. (l7) Nicht einmal darüber, ob der Plural oder der Singular zutreffend sei, hielt er Klarheit für notwendig.
Ein aufmerksamer Leser muss sich, wird er so durch die verschiedenen Metaphern gejagt, genarrt vorkommen. Genarrt kommt sich der Leser schon in der Einleitung vor (20), in der er hin- und hergeschaukelt wird zwischen der Frage nach der religiösen Eigenart als Grund für die Entwicklung des kapitalistischen Geschäftssinns und der umgekehrten Frage nach der ökonomischen Eigenart bestimmter Gebiete als Grund für deren religiös-kirchliche Option. Aus diesem Wechselbad zieht sich der Verfasser heraus mit der Erklärung, es ginge um die »innere Verwandtschaft« zwischen dem altprotestantischen Geist und der modernen kapitalistischen Kultur – wobei es dem Leser überlassen bleibt, was er sich unter »innerer Verwandtschaft« vorstellen will.
Am liebsten beruft er sich in den Anmerkungen auf Richard Baxter, den bekanntesten presbyterianischen Prediger der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Aber in Baxters Predigten spielt die Prädestinationslehre keine bedeutende Rolle, sie geben für die entscheidende Frage nach dem Umgang damit nichts her (das belegen auch alle von Weber selbst gebotenen Zitate - man sollte sie nur mal lesen). In der Auseinandersetzung mit Rachfahl bekräftigt Weber (21), dass Baxter für ihn das wichtigste Quellenmaterial dargestellt habe – neben Philipp Jakob Spener. Der jedoch war weder Calvinist noch Engländer. An einer Stelle versteigt sich Weber hinsichtlich der puritanischen Erbauungsliteratur zu der Behauptung, man müsse »diese ganze Literatur wirklich gründlich kennen, um sie richtig zu benutzen« – mit der Unterstellung, dass er das tue. (22) Und bei so »gründlicher Kenntnis« führt er nur einen solch winzigen Strang dieser »ganzen Literatur« an! Und dabei keinen Beleg für seine Sicht der puritanischen Prädestinationsbewährung! Das kann nur jemanden überzeugen, der von vornherein blind entschlossen ist, sich überzeugen zu lassen.
Dass die dogmatische Theologie den inneren Zusammenhang von Prädestinationsglaube, Angst um Gewissheit und systematischem Berufseifer nicht präsentiert (auch Calvin nicht), sagt Weber selber öfter. (23) Das verwehrt einem, ihm direkte Aussagen von oder über Calvin zuzuschreiben. Aber worauf stützt er sich statt dessen? Er verweist auf »das religiöse Tagebuch«, aus dem dieser innere Zusammenhang in existentieller Weise hervorleuchte, indem da »der reformierte Christ« sich selbst »den Puls fühlt« und »die sittliche Buchführung« als »alleiniges [!] Erkenntnismittel der von Ewigkeit her beschlossenen Erwählung oder Verwerfung« benutzt. (24) Fragt man, worum es sich bei diesen, der sittlichen Selbstkontrolle in Hinsicht auf die ewige Erwählung dienenden, Tagebüchern handele, so erfährt man nur, dass noch Benjamin Franklins – nicht mehr religiös orientierte (25) – Buchführung über Tugendfortschritte »ein klassisches Beispiel dafür sei« (also: Das nicht-religiöse Tagebuch aus dem 18. Jahrhundert als »klassisches« Beispiel für das religiöse Tagebuch des 17. Jahrhunderts!) und dass im deutschen Luthertum der Bewährungsgedanke nicht solche Wichtigkeit gehabt habe. Aber man erfährt nicht, was für religiöse Tagebücher denn nun gemeint sind: von wem sie geschrieben sind (nicht ein einziger Name fällt!), was für Berufe die Schreiber innehatten, wo die Bücher heute lagern und zu finden sind, was überhaupt drinsteht – nichts, rein gar nichts. Ich enthalte mich jeder Bewertung einer so gearteten »rein historischen Darstellung« und möchte nur sagen, dass jeder, der an dem von Weber behaupteten inneren Zusammenhang von Erwählungsglaube, Angst um Gewissheit und methodischem Berufseifer im Calvinismus irgendwie festhalten möchte, als erstes verpflichtet ist, wenigstens das eine oder andere solcher religiösen Tagebücher beizubringen und daraus das von Weber bloß Behauptete zu belegen. Dann – aber erst dann – wird man weitersehen können.
Weber selber scheint nicht damit gerechnet zu haben, dass sich historische Belege auftun lassen, erklärt er doch, dass er »die religiösen Gedanken« nur »in einer ‚idealtypisch’ kompilierten Konsequenz vorführe, wie sie in der historischen Realität nur selten anzutreffen war«. (26) Seine Begründung für die Konstruktion eines »Idealtypus« widerspricht jedem gesunden Menschenverstand: »Denn gerade wegen der Unmöglichkeit, in der historischen Wirklichkeit scharfe Grenzen zu ziehen, können wir nur bei Untersuchung ihrer konsequentesten Formen hoffen, auf ihre spezifischen Wirkungen zu stoßen.« Doch wenn die Wirkungen so breit und folgenreich waren, wie Weber sie annimmt: wenn das puritanische Prädestinations-Ethos nicht weniger als den englischen und dazu noch den amerikanischen »Volkscharakter« geprägt haben soll, dann müsste es »in der historischen Realität« doch wohl häufig und breit anzutreffen gewesen sein – oder diese breite Wirkung kommt eben von etwas anderem. Mit seiner »Idealtypus«-Lehre vertuscht Weber in einer historischen Untersuchung nur die völlig unzureichende Quellenlage. (27)
Es sieht so aus, dass Weber die Eigenart puritanischer Ethik gar nicht aus Quellen bezogen hat, sondern aus einer eigenen psychologischen Konstruktion, mit der er die Auswirkungen der Prädestinationslehre auf die Psyche der Gläubigen sich ausgedeutet hat. (28) Er sagt mehrfach, der Prädestinationsglaube musste die Gläubigen einsam machen und unsicher über ihren Gnadenstand. (29) Das hat er sich offensichtlich so vorgestellt. Und diese psychologische Deutung erschien vielen so plausibel, dass sie nach irgendwelchen Belegen gar nicht gefragt haben. Nun »weiß« eine psychologische Deutung ja auch immer mehr und anderes, als die Gedeuteten selber sagen ...
Sie ist in diesem Falle aber ein unwahrscheinliches Konstrukt. Die Erwählungslehre handelt zwar von der individuellen Erwählung der Einzelnen, dieser Glaube vollzieht sich aber in der Gemeinde, in der Teilhabe an der Gemeinschaft der Erwählten. Insofern ist er ein Kollektivglaube von großer integrativer Kraft. Das hat sich vor allem in den Verfolgungen der Gemeinden bewährt. – Und nur durch seinen Gemeinschaftscharakter war auch die Säkularisierung des Erwählungsglaubens möglich: die historische Verschiebung vom Glauben an die Erwähltheit der eigenen christlichen Gemeinde zum Glauben an die Erwähltheit des eigenen Volkes. Hier liegt die realitätshaltige Forschungsaufgabe hinsichtlich der Auswirkungen der Prädestinationslehre im Calvinismus – nicht nur in der Geschichte der Buren, sondern auch in der Englands. Hierzu wäre auch die Wichtigkeit des Alten Testaments im Calvinismus zu nennen, die Max Weber wohl bemerkt hat; aber inhaltlich hat er dabei den Gedanken der individuellen Erwählung nicht in den Gemeinschaftsgedanken einordnen können.
Das ist um so merkwürdiger, als es gerade der sog. frühen pietistischen Literatur, auf die er sich stützte, zentral um die Gemeinschaftsgebundenheit geht. Es lag damals schon das Buch von Heinrich Heppe vor: »Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche, namentlich der Niederlande« (1879 in Leiden erschienen), das zu Beginn »die Anfänge des Pietismus in England und Schottland« behandelt (also wovon Weber die ganze Literatur gründlich zu kennen vorgab). Daraus geht das starke Interesse der Erbauungsschriftsteller an einer aktiven Einbindung der Gemeindeglieder in den Gemeindegottesdienst hervor. Beim Privatleben geht es ihnen besonders um den häuslichen Gottesdienst, um regelmäßiges Bibellesen und Beten, außerdem um Kontemplation sowie um innergemeindliche Tugenden wie: Kranke besuchen, Arme speisen, Feindschaften auflösen.
Inzwischen haben wir noch die Darstellung von August Lang bekommen: »Puritanismus und Pietismus« (Neukirchen 1941, repr. Nachdruck Darmstadt 1972), die das von Heppe entrollte Bild bestätigt und reich ergänzt. Auch da kommt das Problem individueller Prädestinationszweifel nicht vor. Die Vereinzelung haben die frühpietistischen Erbauungsschriftsteller als Problem in anderem Sinne vor Augen: als Nachlässigkeit, die die Gefahr der Gleichgültigkeit und der Anpassung an die Ungläubigen in sich birgt. Demgegenüber und deshalb mahnen sie zur Gemeindebindung. Das Berufsleben wird nur nebenbei behandelt, es erscheint bei Lang – Heppe berichtet dazu nichts – nur in der traditionellen Warnung vor Wucher.
Schließlich: Auch Webers psychologische Deutung, dass der Prädestinationsgläubige in tiefe Zweifel und Unsicherheit fallen müsse, ist wenig überzeugend. Eher macht der Erwählungsglaube sichere und rechthaberische Leute. Weber musste denn auch feststellen, dass die Puritaner von ihren Seelsorgern vor Hochmut und selbstgefälliger sittlicher Bequemlichkeit gewarnt wurden. (30) Für die Trostbeschaffung durch methodischen Berufseifer dagegen hat er nichts an Textgrundlagen aufgeboten, obwohl er behauptet, dass davon in der Seelsorge und in Erbauungsbüchern andauernd die Rede gewesen sei.
Die Belegstellen, die Weber zitiert, reden durchweg recht allgemein von der Notwendigkeit eines frommen Lebens, das sich von Sünden freihält, das nicht auf anderer Leute Kosten lebt und zu Fleiß und zu Verzichten bereit ist. Dazu gehört die Ablehnung des Bettelns und die Verpflichtung zu eigener Arbeit und zur Fürsorge für die Hilfsbedürftigen. Die Beziehung zur Prädestinationsanfechtung und Prädestinationsbewährung auf der einen Seite und zum methodischen Berufseifer oder gar Geldanhäufen auf der anderen Seite findet sich nur in Webers eigenen Aufstellungen, aber so hartnäckig, dass der Leser unwillkürlich geneigt ist, sie in die historischen Belegstellen mit hineinzulesen. Ist man darauf einmal aufmerksam geworden, bricht das ganze Gebäude zusammen. Damit will ich nicht behaupten (schon weil ich »diese ganze Literatur« nicht »wirklich gründlich kenne«), dass Weber nicht auch Zutreffendes gesehen haben könnte – wenn es denn Belege dafür gibt. Nur: die müssten erst noch vorgelegt werden. (31)
IV.
Man fragt sich natürlich, weshalb eine so windige Angelegenheit wie die sog. Max-Weber-These (die gar keine klare These ist) so »einleuchtend« erscheint und sich so großer Popularität erfreut. Das kann nicht nur an der eben gekennzeichneten suggestiven Aufmachung liegen, das muss seine Gründe auch in der Problemstellung selber haben. Sie scheint eine verbreitete existentielle Frage anzusprechen und aufzunehmen. Es ist m.E. die Frage, wie der Kapitalismus so sehr unser aller »Schicksal« hat werden können, wie schon zu Webers Zeit offensichtlich war. Diese Frage ist wahrlich dringlich – noch dringlicher für die, die dem Kapitalismus gegenüber kritisch eingestellt sind oder an ihm leiden, als für die, die ihn bejahen oder sich mit ihm mehr oder weniger bewusst arrangieren. Und Max Webers genannte Aufsätze kamen aus einer – etwas resignierten – kapitalismuskritischen Stimmung und traten auf deren Wogen ihren Siegeszug an.
Gleichzeitig verhalten sie sich dem historischen Materialismus gegenüber abweisend und sprechen so diejenigen an, denen es um den »Geist« geht. Und auch das in spezieller und aktueller Fragestellung: bei der Suche nach den – unsicher gewordenen – gemeinsamen »Werten«. Diese Fragestellung lässt Soziologie immer wieder zur Religionssoziologie werden – in der Hoffnung, in der Religion die gemeinschaftsbildenden resp. gemeinschaftserhaltenden »Werte« samt der sie setzenden Institutionen zu finden – wenigstens im historischen Rückblick, wenn schon eine gegenwärtige bestimmte wertbestimmende Religion nicht auszumachen ist.
Das scheint mir das Klima zu sein, das für Entstehung und Erfolg der Weberschen Kapitalismus-Protestantismus-Aufsätze in Rechnung zu stellen ist. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass die bisherigen geistesgeschichtlichen Erklärungsversuche zur Herausbildung der kapitalistischen Neuzeit ziemlich unbefriedigend waren. Als Beispiel zitiere ich Webers Freund Ernst Troeltsch, der in dem – auch von Weber genannten (32) – Artikel über Englische Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts (in der 3. Aufl. der RE, Bd. 13, 1903) zu dem hier interessierenden Thema hat verlauten lassen, dass man im Reformiertentum »einem politischen und wirtschaftlichen Utilitarismus« »huldigte«, der »unterstützt« wurde durch »die christlichen Forderungen der Mäßigkeit, Rechtlichkeit und Arbeitsamkeit, in denen sich das Evangelium als auch dem materiellen Gedeihen förderlich erweist. So werden die reformierten Länder Träger der Kapitalwirtschaft, des Handels, der Industrie und eines christlich temperierten Utilitarismus.« – »Wer in der Prädestination seines Zieles und des Jenseits so unbedingt sicher ist, der kann die natürlichen Kräfte um so freier auf den natürlichen Zweck, den Erwerb, wenden und braucht keine übermäßige Liebe zum irdischen Gut dabei zu fürchten.« (33) Neben solchen vagen Verlegenheitsauskünften nimmt sich Webers »These« von der Prädestinationsunsicherheit tiefgründig und scheinbar plausibel aus – selbst wenn sie keine »These« ist.
Der unübersehbaren Schwäche einer Beschränkung auf den »Geist« des Kapitalismus versucht man häufig dadurch zu entgehen, dass die Zinsfrage mit hereingenommen wird. In der Zinsfrage berührt sich Ideelles mit Praktischem, und man scheint der Frage der Kapitalbildung und damit dem Kapitalismus als wirtschaftlicher Realität nahezukommen. Weber hatte allerdings abgelehnt, den Protestantismus-Kapitalismus-Zusammenhang an der Zinsfrage zu verhandeln (34), es lässt sich ja auch nicht nachweisen, dass die calvinische oder spätere reformierte Einstellung zum Zins etwas Besonderes war, das wirtschaftlich innovatorisch hätte wirken können. (35) Vor allem aber ist zu bedenken, dass (a) das Zinsnehmen schon Kapital voraussetzt, das dann mit Zinsforderungen verliehen werden kann, und dass (b) neues Kapital hervorgebracht werden musste, um das geliehene mit Zins zurückgeben zu können. Das erste (a) impliziert eine historische Frage, die zeitlich hinter den angeblich wirtschaftlich innovatorischen Calvinismus zurückfragen lässt, das zweite (b) führt zur Frage nach der Art kapitalistischer Kapitalbildungsprozesse, die mit dem Verweis auf Zinssätze nicht beantwortet, ja nicht einmal in den Blick genommen ist. Dazu müsste man schon vom Mehrwert handeln. Die Fixierung auf die Zinsfrage ist auch noch eine Verstellung einer realitätshaltigen Beschäftigung mit der Entstehung des neuzeitlichen Kapitalismus.
V.
Doch das sei nur am Rande vermerkt. Zur Hauptsache, die uns auf diesem Symposion interessiert, kommen wir, wenn wir beachten, dass Max Weber sich bei seiner Bestimmung des puritanischen Erwählungs-Ethos neben der Psychologisiererei auf eigene Faust noch auf ernsthaftere Anhaltspunkte gestützt hat. Er hat sich (seiner eigenen Behauptung zuwider) zwar nicht in frömmigkeitsgeschichtlichen, wohl aber in theologiegeschichtlichen Lehrbüchern umgesehen, und in denen war es verbreitet, die Prädestinationslehre als Zentrallehre des Calvinismus zu präsentieren. Man denke an Alexander Schweizers Werk von 1854/56. (36) »Ganz besonders verpflichtet« jedoch sah sich Weber der »Vergleichenden Darstellung des lutherischen und reformierten Lehrbegriffs« von Matthias Schneckenburger (aus dem Nachlass ediert von E.Güder, Stuttgart 1855). (37)
Es ist dieses Buch, in dem man auf eine Bemerkung stößt über die »gerade auf dem Boden der reformierten Askese aufgekommene Sitte der Tagebücher« – einschließlich des (von Weber als unbelegtes Zitat benutzten) Ausdrucks »sich den Puls zu fühlen«. (38) Vor allem ist zu registrieren, dass es Schneckenburger war, der die Eigenart der reformierten Frömmigkeit (im Unterschied zur lutherischen) auf den einen Punk zusammengezogen hat: dass der Reformierte zur »Selbstgewissheit« seines Glaubens als Teilhabe an Gottes Erwählung nur durch die reale ethische Betätigung des Glaubens nach außen komme, während der Glaube der Lutheraner seine Gewissheit in sich selbst trage und aus dem Sakrament und dem Absolutionswort gespeist werde. (39) Bei Schneckenburger findet sich die Linie auch ausgezogen zum deutschen Pietismus, namentlich zu Spener, durch den die reformierte Ansicht in das Luthertum hineingekommen sei. (40) Was Weber bei Schneckenburger nicht fand, ist die Berufung auf Baxter, ist der Begriff »Bewährung« und die angebliche Konzentration der reformierten ethischen Betätigung auf die methodische Berufserfüllung. Darin muss man wohl das Eigene von Webers Konstruktion sehen - wobei es weitere Untersuchungen erfordert, wie er auf diese Kombination gekommen sein mag.
An Schneckenburger erinnert aber noch etwas anderes: dass er die Lehransicht von der Heilsvergewisserung durch Werke auf die psychische Mentalität der Träger dieser Ansicht bezieht. (41) Doch er geht genau andersherum vor als Weber: Der Theologe rekurriert zur Erklärung theologischer Glaubenssätze auf vorgegebene, sie bedingende Mentalitätsstrukturen, während Weber umgekehrt Mentalitätsausprägungen auf theologische Lehren zurückführt und mit von ihnen ausgelösten Bedrängnissen erklären will. Es ist fast lustig: Der Theologe meint seinen Stoff nur verstehen zu können mit Hilfe des Rückgriffs auf die Mentalität, und der Mentalitätsforscher den seinen nur mit Hilfe des Rückgriffs auf die Theologie. – Vielleicht sind deshalb manche Theologen so erfreut auf Weber angesprungen, (42) weil sie sich für ihr Gebiet nun nicht mehr anderswo nach Erklärungen und Verstehenshilfen umsehen müssen, sondern mit ihrem (inzwischen recht abständig gewordenen) Stoff plötzlich als letzter Erklärungs- und Verstehensbezug dastehen.
Man kann Schneckenburgers und Webers Bestimmung der calvinistischen Eigenart gebündelt sehen in dem, was man den »Syllogismus practicus« nennt. Schneckenburger beginnt denn auch damit. (43) Dabei geht es jetzt um die Sache, nicht um den Begriff. Gemeint ist, dass das christliche Gemeindeglied aus der Praxis seiner »Heiligung«, also der inneren Bewegtheit und des äußeren Eifers seiner eigenen christlichen Existenz, die Folgerung ziehen könne, dass es einen lebendigen christlichen Glauben hat und somit zu den Erwählten sich zählen darf. (44)
Auch wenn sich Schneckenburgers Ansicht nicht durchsetzen konnte, dass der »Syllogismus practicus« das charakteristische Merkmal der reformierten Lehre sei, so gilt er nach allgemeiner Annahme doch als eine Eigentümlichkeit gerade reformierter Theologie, die im Luthertum nicht vorkomme. Ich benutze die Überbetonung seiner Wichtigkeit durch Schneckenburger und Weber, um dem theologiegeschichtlich nachzugehen - und bitte dafür um Ihre Geduld.
VI.
Dabei muss sofort die übliche Meinung korrigiert werden, als sei diese Lehre eine calvinistische Eigentümlichkeit. Sie ist vielmehr durch Luther in die protestantische Theologie gekommen und hat sich auch in den lutherischen Bekenntnisschriften niedergeschlagen. Calvin hat sich hier nur an Luther gehalten – eher ihn abschwächend als verstärkend.
In der ersten Evangeliumspredigt in der Wartburgpostille von 1521 erklärt Luther, gute Werke, die man tut, seien »ein gewiss Zeichen des Glaubens. [...] Darum erkennt der Mensch aus seinen Früchten, was er für ein Baum ist, und an der Liebe und den Werken wird er gewiss, dass Christus in ihm ist. [...] Wenn ihr euch frisch übt in guten Werken, so werdet ihr gewiss und könnt nicht zweifeln, dass euch Gott berufen und erwählt hat.« (45) Das ist in Luthers präziser Ausdrucksweise, was als charakteristisch nicht-lutherisch gilt! Dabei ist diese Aussage gerade aus Luthers Mund sinnvoll; denn er stand unter dem Druck der traditionellen Frömmigkeit, der zufolge gute Werke dem, der sie tut, selber nützen, indem sie ihn bei Gott in irgendeiner Weise – das wurde differenziert – angenehm machen. Da Luther diese Auffassung abgelehnt hatte und seiner Erkenntnis nach der Mensch ohne Werke nur durch Gottes Gnade im Glauben an Christus selig wird, blieb eine offene Frage, was gute Werke denn nützen. Gewiss, sie sollen dem Nächsten nützen. Aber auch noch dem, der sie tut, selber? Daraufhin Luthers Antwort: Ja, und zwar indem sie Zeichen sind für den eigenen Glauben an Christus; sie machen dem Gläubigen seine Erwählung gewiss. »Gewissheit« ist der leitende Begriff, und die Frage nach der Erwählungsgewissheit war ja ein Grundproblem von Luthers Frömmigkeit im Kloster gewesen. Er kann sogar sagen, die Liebe »beweist und bewährt« (hier kommt der von Weber als typisch reformiert bezeichnete Bewährungsbegriff herein), dass im Glauben die Sünde getilgt ist. (46) Als entscheidende Bibelstelle wird von Luther 2.Petr 1,10 zitiert – in seiner Übersetzung: »Lieben Brüder, tut fleißig, dass ihr durch gute Werk euren Beruf und eure Erwählung gewiss machet«. (47)
Den Gedanken hatte Luther vorgefunden (48), er hat ihn aber mit Hilfe des Zeichenbegriffs seiner Rechtfertigungslehre zu- und unterordnen können. So gefasst lässt er sich auch einsetzen zur Auslegung von Bibelstellen, die der evangelischen Grundeinsicht zu widersprechen scheinen. Die wichtigste und bekannteste Bibelstelle dieser Art ist die 5. Bitte des Vaterunsers: »Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern« (Mat 6,12; Luk 11,4). Wie hängen die beiden Satzteile zusammen? Ist der Zusammenhang so gemeint, dass Gottes Vergebung davon abhängt, dass wir unseren Schuldigern vergeben, so dass dann letztlich doch unser gutes Werk Gottes Vergebung bewirkt? Nein, antwortet Luther, Gott vergibt frei umsonst aus lauter Gnade, seiner Verheißung entsprechend, aber: Dass auch wir unseren Schuldigern vergeben, dient dazu, dass wir neben der Verheißung auch ein Zeichen haben, aus dem wir die Gewissheit gewinnen, dass wir in Gottes Gnade stehen und von Gottes Vergebung erreicht sind. So steht es in Luthers großem Katechismus (1529) in der Auslegung dieser Bitte. (49)
Diese Argumentationsfigur war dadurch gut verstehbar, dass sie mit dem Begriffspaar Verheißung (promissio) – Zeichen (signum) an den Sprachgebrauch der Sakramentslehre anknüpfte. Luther hat das im Großen Katechismus auch expressis verbis deutlich gemacht: »Denn wieviel die Taufe und Sakrament [= Abendmahl], äußerlich zum Zeichen gestellt, schaffen, soviel vermag auch dies Zeichen: unser Gewissen zu stärken und fröhlich zu machen.«
Auf dem Augsburger Reichstag (1530) konnte Melanchthon diese Argumentation Luthers zur Verteidigung der evangelischen Sache übernehmen. Die römisch-katholischen Einwände gegen die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung und Sündentilgung allein aus dem Glauben hatten auch die 5. Bitte des Vaterunsers angeführt: An ihr sähe man, dass menschliche gute Taten (hier: unser Vergeben) Voraussetzung bzw. Bedingung für Gottes Vergeben seien. Zur Entkräftung dieses Einwandes arbeitete auch Melanchthon in der Apologie mit der Kennzeichnung der guten Werke als Zeichen (signa) zur Stärkung der Glaubensgewissheit nach Analogie der Rolle der Elemente (Wasser und Brot und Wein) bei Taufe und Abendmahl. Diese äußerliche Zeichen helfen den erschrockenen Gewissen, kräftiger an die Vergebung zu glauben. (50) Der Komparativ »kräftiger“ (firmius) dient der Vorsicht bei Benutzung dieses Gedankens: Er will festhalten, dass die Grundgewissheit allein im Glauben an Gottes Verheißung ruht; die eigenen guten Werke können sie nicht hervorbringen, sondern nur stärken und lebendig erhalten.
Calvin nun hat sich streng an diese Texte aus der lutherischen Reformation angeschlossen, sowohl in der Terminologie als auch in den inhaltlichen Zusammenhängen. An genau den beiden von Luther vorgegebenen Sachproblemen – bei der grundsätzlichen Frage: Was nutzen gute Werke dem, der sie tut?, und bei der Auslegung der 5. Vaterunserbitte – erscheint der Syllogismus practicus in Calvins Institutio. Nur an diesen beiden Stellen, nicht innerhalb der Erwählungslehre! Es handelt sich um Inst III, 14,18-20 (zur Frage nach dem Eigennutzen der guten Werke, verfasst zur 2. Aufl. 1539 in Straßburg, mit Ergänzungen von 1543 und 1559), und um Inst III,20,45 am Ende (zur 5. Vaterunserbitte, stammt schon aus der 1. Aufl. von 1536 und ist so beibehalten worden). Luthers deutsche Texte waren für Calvin dadurch zugänglich gewesen, dass sie sofort nach Erscheinen ins Lateinische übersetzt worden sind und so ihren Einfluss auf die außerdeutsche Reformationsgeschichte ausüben konnten. Die Wartburgpostille war 1525 von Martin Bucer übersetzt, dem Straßburger Reformator und späteren Freund Calvins während dessen Straßburger Zeit. Bucer hatte »Zeichen« – vielleicht aus Abneigung gegen die Sakramentstheologie? – mit »testimonia« übersetzt. (51) Auch Calvin spricht an der sachlich entsprechenden Stelle Inst III,14,18-20 von »testimonia« (im Wechsel mit »signa«), während in der älteren Stelle zur 5. Vaterunserbitte Inst III,20,45 nur »signum« steht. Das verweist auf die damals gängige Übersetzung von Luthers Großem Katechismus, die »Zeichen« nur mit »signum« wiedergegeben hatte. (52)
Erwähnenswert ist, dass Calvin dabei nur einmal und eher nebenbei das Wort »Erwählung« (electio) benutzt, (53) ansonsten sagt er in mancherlei Ausdrücken, dass unsere guten Werke Zeichen unseres Glaubens an Christus seien bzw. der Gegenwart Gottes in uns. Das läuft der Sache nach auf dasselbe hinaus, es ist aber eine besondere Akzentsetzung, die damit zusammenhängen wird, dass Calvin innerhalb der Erwählungslehre im Abschnitt zur Gewissheitsfrage (Inst III,24) einen Hinweis auf den Gedanken des Syllogismus practicus vermeidet. Auch die von Luther zitierte Bibelstelle 2. Petr 1,10 wird von Calvin ansonsten nicht herangezogen.
In seinem Kommentar zu dieser Stelle im Rahmen der Auslegung der sog. Katholischen Briefe (1551) erfahren wir den Grund: (54) Calvin meint, in 2. Petr 1,10 stecke die Schwierigkeit (quaestio), dass man sie auch so verstehen könne, als ob sich der Bestand (stabilitas) unserer Berufung und Erwählung auf unsere guten Werke stütze und damit dann doch von uns abhänge. Mit solcher Auffassung aber würde dem sonstigen Bibelzeugnis von Gottes freier Gnadenwahl widersprochen. Calvin stellt Klarheit her mit Hilfe von Luthers Deutung der guten Werke als Zeichen zur Vergewisserung unserer Erwählung – mit dem ausdrücklichen Zusatz: »doch so, dass die Gläubigen ihr festes Fundament anderswo haben«, gemeint ist: nicht an ihren Werken, sondern am Heilswerk Christi im Glauben daran. Weil 2. Petr 1,10 hierzu nicht präzise genug differenziert und den klärenden Zeichenbegriff nicht verwendet, hatte Calvin Hemmungen, diese Stelle unbefangen zu zitieren.
Am Rande sei erwähnt: Es bestand eine Differenz zwischen Karl Barth und Wilhelm Niesel darüber, ob der Syllogismus practicus bei Calvin vorkommt oder nicht. Ich meine, dass beide Recht hatten: Barth darin, dass die Sache des Syllogismus practicus in der Tat von Calvin vertreten wird, Niesel darin, dass dies nicht innerhalb der Prädestinationslehre geschieht. Die Abhängigkeit von Luther hatten beide nicht gesehen, ebenso wenig die Bedeutung und zugleich Problematik von 2. Petr 1,10.
Aus Katechismen der Reformationszeit ist zu berichten, dass unter der ersten von Luthers Fragestellungen (Was nützen gute Werke dem, der sie tut?) der Gedanke des Syllogismus practicus vom späteren, kürzeren Katechismus des Leo Jud (Zürich 1541) und vom Heidelberger Katechismus (1563) gelehrt wird. Beide Male als Nebengedanke zur Begründung der Notwendigkeit guter Werke unter dem Gesichtspunkt des Gewiss-Werdens und mit Berufung auf 2. Petr 1,10. (55) Beide Male allerdings unter Auslassung des für Luther und Calvin entscheidenden und klärenden Zeichenbegriffs! (56) In den beiden von Calvin für Genf verfassten Katechismen (1537 und 1542) wird – wie in Luthers Großem Katechismus – der Syllogismus practicus bei der Unservaterauslegung gelehrt, und nur da. Der Begriff des Zeichens ist dabei in mannigfachen Ausdrücken konstitutiv. (57)
VII.
Hundert Jahre später entstehen die Dokumente der Westminster-Synode. Da Max Weber die Westminster-Confession bemüht, sei darauf noch eingegangen. In den beiden Westminster-Katechismen wird bei der Erklärung der 5. Bitte des Herrengebetes ebenso wenig wie im Heidelberger Katechismus vom Syllogismus practicus Gebrauch gemacht. Es ist merkwürdig, dass Luthers Erklärung dieser Stelle so wenig Eindruck gemacht zu haben scheint – außer auf Calvin! Zur Frage, was gute Werke dem nutzen, der sie tut, wird in der Westminster-Confession (nicht in den Westminster-Katechismen) genau wie im Heidelberger Katechismus bei der Begründung der Forderung nach guten Werken auf den Syllogismus practicus als Nebenargument zurückgegriffen, (58) wieder unter Verweis auf 2. Petr 1,10 und wieder unter Ignorierung des Zeichenbegriffs. Darüber hinaus kommt der Syllogismus practicus in der Confession auch im Kapitel über das ewige Dekret Gottes vor – eine Neuerung gegenüber Calvin. Doch Max Weber hat diese Stelle nicht für sich angeführt - sie passt auch schlecht zu seiner These von der Prädestinationsverzweiflung und deren Bekämpfung mittels methodischen Berufseifers und Geldscheffelns. Der Zusammenhang nämlich ist die Mahnung, das hohe Geheimnis der Prädestination mit äußerster Umsicht und Vorsicht zu behandeln, und das heißt: in strenger Bindung an das offenbarte Wort Gottes und im schuldigen Gehorsam gegenüber Gottes Wort, durch den man der Berufung gewisser werde – wieder mit Verweis auf 2. Petr 1,10. (59) Dahinter scheinen mir die Dordrechter Beschlüsse von 1618/19 zu stehen, die im Kap. 1,12 von »unfehlbaren Früchten der Erwählung« sprechen, »als da sind: wahrer Glaube an Christus, kindliche Furcht Gottes, gottgemäßer Schmerz über die Sünden, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit.« (60)
Schließlich ist noch Kap. 18 der Westminster-Confession zu nennen mit der Überschrift: »Von der Gewissheit der Gnade und des Heils«. (61) Gewissheit/certitudo/assurance – das ist das Stichwort, um das es geht. Und mit dem Ausdruck »Bewährung« meinte Weber vermutlich ein solches Verhalten, das zur Gewissheit über das eigene Erwähltsein führt. Das Ausgangsproblem für die Westminster-Confession ist aber auch hier nicht die Unsicherheit der vereinzelten Gläubigen über ihr Erwähltsein, vielmehr ist es in diesem Fall das praktische Kirchen-Problem: dass der christlichen Gemeinde auch Heuchler angehören, die sich fälschlich anmaßen, dazuzugehören und in der Gnade Gottes zu stehen. Demgegenüber charakterisiert Abschn. 1 die Nicht-Heuchler so: »Die aber wahrhaft an den Herrn Jesus glauben und ihn aufrichtig lieben, indem sie bestrebt sind, vor ihm in jedem guten Gewissen zu wandeln, die können in diesem Leben gewiss werden, dass sie sich im Stande der Gnade befinden, so dass sie auch fröhlich sein können in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, welche Hoffnung sie nie beschämen wird.« (62)
Deutlicher wird dieser Text durch die beigegebenen Verweise auf Bibelstellen, vor allem aus dem 1. Johannesbrief (2,3-6; 3,13-24), worin es heißt: »Daran merken wir, dass wir ihn [Jesus Christus] kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist die Wahrheit nicht« (2,3f), oder: »Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tode« (3,14). An der Liebe zu den Mitchristen als der Erfüllung der Gebote zeigt sich die Jesusliebe, und daran unterscheidet sich der aufrichtig Glaubende vom Heuchler. Insofern hilft das ethische Verhalten zur Gewinnung von Unterscheidungs-Gewissheit. (Diese Stellen aus dem 1. Johannesbrief bekamen ähnlichen Rang wie 2. Petr 1,10.) Es sei aber unterstrichen, dass es um die »Liebe zum Bruder« geht – der Gedanke an den »Beruf« oder gar den »Beruf an sich« ist auch hier durch nichts nahegelegt.
Außerdem muss man beachten, dass der nächste Abschnitt die Gewissheit aus dem »Streben nach einem Leben in gutem Gewissen« ausdrücklich der Gewissheit aus dem Glauben an die Verheißung Gottes unterordnet: Die Heilsgewissheit ruht nicht auf den eigenen Bestrebungen oder Taten, sondern auf der Gnadenverheißung Gottes, die die unumstößliche Wahrheit ist. Auch die aktive Existenz in dieser Gnade ist erzeugt und gespeist aus dem göttlichen Wort der Wahrheit und dem Glauben daran. Und auch die Gewissheit aus der Bruderliebe ist Glaubenserkenntnis aus dem heiligen Geist. (63) Dementsprechend bezeichnet die Confession im 3. Abschnitt als »Früchte der Gewissheit«, was man nach dem 1. Abschnitt als Mittel zur Gewissheit ansehen könnte: dass »das Herz weit wird in Friede und Freude im heiligen Geist, in Liebe und Dankbarkeit zu Gott und in Strenge und freudigem Eifer in Gehorsamstaten«. Als wichtigste Bibelstelle wird jetzt wieder 2. Petr 1,10 genannt, welche Stelle auch in den Wortlaut der Confession eingeht: »Daher ist jeder gehalten, allen Fleiß darauf zu richten, dass er sich seine Berufung und Erwählung gewiss mache« (quo vocationem suam sibi et electionem certam faciat / to make his Calling and Election sure).
»Berufung« (vocatio/calling) meint hier nicht den bürgerlichen Beruf, sondern die Berufung zum glaubenden Kind Gottes, zum Mitglied der Schar der Erwählten. Der entscheidende Gesichtspunkt ist dabei der des Gehorsams gegenüber Gott, und für den gilt als Maßstab – wie wir sahen – das Gesetz der Nächstenliebe, vor allem gegenüber den Mitgliedern der eigenen Gemeinde. Und schließlich: Die Gewissheit gibt der heilige Geist durch die Verheißung Gottes – man darf vielleicht sagen: im Prozess der praktizierten Nächstenliebe. Den Prozesscharakter der Gewissheitsfindung betont die Confession zu Beginn des 3. Abschnitts ausdrücklich, indem sie erklärt, dass die Substanz (Essenz) des christlichen Glaubens nicht vom Grad der Gewissheit abhänge.
Sicher: Die Verlautbarungen der Westminster-Synode waren nicht die Messlatte, an der entlang sich das Frömmigkeitsbewusstsein und das Ethos der evangelischen Gemeinden in England und Nordamerika entwickelt haben. Nur: Falls sie sich wirklich im Sinne von Webers Darstellung entwickelt haben sollten, müsste dafür eben anderes aufgeboten werden als Theologie, müssten die Weichenstellungen gezeigt und die Verbreitung des von Weber Behaupteten nachgewiesen werden können. Und das suche ich bei Weber vergebens. Mehr kann ich nicht sagen.
Was schließlich Schneckenburgers Darstellung betrifft, so hat schon Alexander Schweizer die Richtung gewiesen (wenn auch etwas kompliziert), in der man sich das Zustandekommen dieser schiefen Sicht wird erklären können. Schweizer schreibt: »Schneckenburgers Ausgangspunkt zur Charakterisierung der reformierten Besonderheit, ‚dass dem Reformierten der Glaube noch nicht die volle Zuversicht des Seligwerdens einflösse, und darum sofort auf die Zeichen des ächten Glaubens, die Werke usw. gesehen werden müsse,’ mag einem mehr lutherisch bewaffneten Auge einleuchten«. (64) Und was das Lutherische ausmacht, von dem Schneckenburgers Blick bestimmt war, das hat Schweizer am Ende des 1. Bandes dargestellt: »Die lutherische Richtung weist alle Heilszuversicht an die ächten kirchlichen Gnadenmittel und allgemein evangelische Verheißung, welchen gegenüber der Mensch schlechthin nur abhängig bleiben kann.« (65) Das habe zu einer anderen Interpretation der Prädestination geführt als im Reformiertentum, vor allem aber werde von da aus unter lutherischer Prägung die reformierte Heilszuversicht, die an den »über aller Wirksamkeit der Gnadenmittel« stehenden »Rathschluss der gnädigen Erwählung« gewiesen ist, als Stochern im Nebel angesehen, das keine wirkliche Zuversicht geben könne, weshalb dieselbe in den eigenen Werken gesucht werden müsse. Die lutherische Theologie orientiert sich »an der in Wort und Sakrament objektiv immer und für jeden sicher vorhandenen Heilskraft« (66), und von da aus kann sie die reformierte, »sofern sie auf Gott abstellt, der die Heilsanstalt mit ihren Gnadenmitteln wirksam macht wo er will«, nicht sachgerecht würdigen, kann sie in ihr keine Objektivität als Haltpunkt finden und muss diesen bei den Reformierten dann anderswo vermuten, etwa eben in den eigenen Werken der Glaubenden.
Weshalb in der reformierten Lehrtradition von der Prädestination die Sache des Syllogismus practicus eine – wenn auch begrenzte – Bedeutung hat bekommen können, erklärt Schweizer mit der Abwehr von Missbräuchen der Botschaft von der Gnadenwahl durch bequeme und unethische Selbstzufriedenheit; dem habe man »durch sorgfältige Hinweisung auf die Werke, in denen die Erwählung sich betätige«, steuern wollen. (67)
VIII.
Abschließend – und von der Westminister-Confession aus auch inhaltlich sinnvoll (wie sich gleich zeigen wird) – möchte ich den Bogen zurück zu Calvins Prädestinationslehre schlagen, nun unter Beachtung der Barthschen Calvin-Vorlesung von 1922. Barth nimmt ernst, dass Calvins Prädestinationslehre in der ersten Institutio Teil der Lehre von der Kirche ist. Der erste Katechismus Calvins verselbständigte dann zwar die Prädestinationslehre zu einem eigenen Abschnitt, beließ sie aber weiterhin als Teil der Kirchenfrage, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Verschiedenheit der Menschen: Einige Menschen nehmen den Samen des göttlichen Wortes auf, andere nicht. (68) Hinzuzufügen bleibt, dass das Prädestinationskapitel der zweiten, der Straßburger Institutio (1539) diesen Ansatz aus dem ersten Katechismus übernimmt - und ihn so bis in die Letztfassung festhält (Inst III,21,1), obwohl der Abschnitt über die Prädestination 1559 erheblich überarbeitet und erweitert worden ist. Das bestätigt Barths Sicht, dass die Prädestinationslehre bei Calvin wesentlich mit dem Thema der sichtbaren Kirche und ihrer Probleme verknüpft ist.
Bei dieser von Barth treffend charakterisierten Grundintention, die so nicht von Luther stammt, könnte das, was man den Syllogismus practicus nennt, ein Teilbereich sein, und zwar ein eigentlich selbstverständlicher Teilbereich einer Prädestinationslehre, die ab ovo die sichtbare und die verborgene Kirche miteinander verknüpft. Calvin hätte also m.E. auch in der Erwählungslehre den Syllogismus practicus lehren können – wenn er nicht zu sehr befürchtet hätte, dass dadurch das Vertrauen der Gläubigen von der Verheißung Gottes abgezogen und auf das eigene Tun gelenkt werde. Wie stark bei ihm diese Sorge war, sieht man daran. dass er auch die Stellen aus 1. Joh 2 und 3, die den Syllogismus practicus stützen, nicht in diesem Sinne heranzuziehen vermochte. Im Kommentar stellt er sowohl zu 1. Joh 2,3 als auch zu 3,14 nachdrücklich klar. dass ein entscheidender Unterschied bestehe zwischen der Ursache des Heils im Erbarmen Gottes und den Früchten, die als hinzukommende Zeichen den Glauben an Gottes Erbarmen unterstützen können. Im Schluss der Auslegung von 1. Joh 2,3 heißt es: »Denn obwohl ein jeder an den Werken ein Zeugnis (testimonium) seines Glaubens hat, folgt daraus doch nicht, dass der Glaube darauf gründet, vielmehr kommt hernach dieser Beweis (probatio) als ein Zeichen (signum) hinzu. (70) Die Gewissheit des Glaubens ruht deshalb allein auf der Gnade Christi, doch Frömmigkeit und Heiligkeit des Lebens unterscheiden den wahren Glauben von eingebildeter und toter Gotteserkenntnis.« (71) Hier stehen wir an einem springenden Punkt der Erwählungslehre. Diese redet vom gnadenhaften Erbarmen Gottes, das im Glauben an Christus angenommen wird. Dementsprechend kann sie nur im Glauben an die Gnade Christi sinnvoll zur Sprache gebracht werden. Dieser Glaube ist aber nur dann nicht fiktiv oder tot, wenn er eine heilige Lebensführung mit sich bringt. Insofern ist die Prädestinationslehre als menschliche Theologie untrennbar mit der praxis pietatis (wenn ich so sagen darf) verknüpft. Barth konnte sagen: mit der Kirchenzucht.
Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen: Das ist nicht nur um des Ineinanders von Glauben und Lebensführung willen so, sondern noch stärker deshalb, weil Calvin die Heiligung als Ziel und Zweck der Erwählung ansah. (72) Ich zitiere aus Calvins Auslegung von 2. Petr 1,10: »Die Hauptsache ist, dass sich die Kinder Gottes durch dies Zeichen von den Verworfenen unterscheiden, indem sie fromm und heilig leben; denn dies ist der Zweck der göttlichen Erwählung (divinae electionis scopus).« (73) Ich finde deshalb die von Herrn Klappert vorgelegte Bestimmung zutreffend: »Die Erwählung der Gemeinde zur Heiligung«. Und die Heiligung, die Askese und Opfer fordert, bedarf der Verankerung in Gottes Wahl, die das einzige ist, das über das Erleben und Erfahren hinausgeht und beständig und unanfechtbar gültig ist. Nur von daher können Menschen ihr Leben der Heiligung weihen.
Dass damit zwei Gruppen von Menschen im Blick sind: die, die sich zur Heiligung rufen lassen, und die, die sich diesem Ruf mehr oder weniger verweigern (in direkter Ablehnung oder als Heuchler), ist unausweichlich. Jedenfalls war es unausweichlich in der Zeit der Leiden und Kämpfe der Gegenreformation, aber auch im Kirchenkampf zu Barths Zeit. Und doch meldete Barth hartnäckig Bedenken dagegen an. In der Vorlesung von 1922 lauten sie so: »Ob Calvin recht hat, wenn er Glauben und Unglauben auf zwei getrennte Menschengruppen verteilt, das ist eine andere Frage. Ich meinerseits verneine sie. Konsequent in der Linie würde es m.E. liegen, laut und kräftig von Gottes freiem Erwählen und Verwerfen zu reden, von den Erwählten und Verworfenen aber kräftig und bedeutsam zu schweigen. Doch es würde zu weit führen, hier darauf einzutreten.« (74)
Was 1922 zu weit geführt hätte, wurde von Barth, wenn ich recht sehe, erst etwa 35 Jahre später in KD IV/3 unter der Überschrift »Die Verheißung des Geistes« konstruktiv durchgearbeitet. Fast abrupt führt er dort am Ende von § 69,4 die beiden Arten von Menschen ein, deren Verschiedenheit Calvin so beschäftigt hat und um die dessen prädestinatianisches Denken kreiste. Die drohende und von Barth abgelehnte Petrifizierung, also die Festlegung von Menschen auf das Erwähltsein oder Verworfensein auf Grund ihrer Erscheinung und der Erfahrung – diese drohende Petrifizierung der doppelten Prädestination verflüssigt und vermeidet Barth, indem er auf die Verheißung des Geistes pocht: Diese Verheißung macht uns offen dafür, dass der Geist Neues schaffen und auch unsere – immer unsicheren – Erfahrungen von Verwerfung gründlich überholen und zu etwas ganz Neuem bringen wird. Das sagt Barth unter dem Leitgedanken der Prophetie Jesu Christi. Wegen der von ihm gelehrten Universalität des Versöhnungswerkes Christi kann, ja muss er die Verheißung des Geistes in dieser Weise als überschwänglich annehmen und die Festlegungen der calvinischen Prädestinationslehre verflüssigen. (Das ist auch ein Beitrag zur Lehre vom Heiligen Geist bei Calvin und Barth, bei dem Barth die größere Offenheit und Weite zeigt – von der Christologie her!)
Inhaltlich wird man registrieren müssen, dass Barth hiermit Abschied nimmt von der langen Tradition des von Nietzsche verhöhnten und gegeißelten christlichen Bedürfnisses nach Rache, nach ewiger Rache an den Heuchlern und an den Feinden der Kirche.
Ich muss es bei diesem Hinweis jetzt belassen. Der Hinweis jedoch war mir wichtig, weil ich der Meinung bin, dass Barths Antwort auf Calvins Prädestinationslehre und ihre Probleme sich nicht in KD II/2 (seiner Lehre von Gottes Gnadenwahl) erschöpft, sondern noch weiterführend auch im weiteren Werk zu finden ist.
Vom Autor Dieter Schellong für die online-Veröffentlichung auf www.reformiert-info.de überarbeitete Fassung seines Beitrags in: Karl Barth und Johannes Calvin. Karl Barths Göttinger Calvin-Vorlesung von 1922, hrsg. von Hans Scholl, Neukirchen-Vluyn 1995, 74–101.
Weitere Aufsätze von Dieter Schellong zum Thema:
1.) Wie steht es um die "These" vom Zusammenhang von Protestantismus und "Geist des Kapitalismus"?, Paderborner Universitätsreden, hg. v. P. Frese, H.47, 1995 (der ausführlichste Text Dieter Schellongs zum Thema), und:
2.) Der "Geist" des Kapitalismus und der Protestantismus. Eine Max-Weber-Kritik, in: R. Faber u. G. Palmer (Hg.), Der Protestantismus - Ideologie, Konfession oder Kultur?, Würzburg 2003, S.231-253.
Anmerkungen
1 In: J.THIELE (Hrsg.): Berlin `89. Impulse für den Kirchentag, Stuttgart 1989, 56f.
2 Erschienen in Tübingen [im folgenden abgekürzt mit Weber I]. Ich benutze die 9. Aufl. 1988, die Seitenzahlen sind in allen Auflagen gleich.
3 Im »Resultat« der 1915-19 erschienenen »Wirtschaftsethik der Weltreligionen«, das einen Vergleich zwischen »Konfuzianisinus und Puritanismus« wagt, Weber I 530 und 532, gelesen auf dem Hintergrund von 526.
4 Vgl. zB. WEBER I 117 Anm.2. 159. 163. 535.
5 E.F.K.MÜLLER (Hrsg.): Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig 1903, 574. Übersetzung (wo nicht anders angegeben) von mir.
6 Vgl. meinen Art. »Ethik B. Aus evangelischer Sicht«, in: P.EICHLER (Hrsg.): Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, erweiterte Neuausgabe Bd. 1, München 1991, 408ff.
7 Vgl. M.LUTHER: Welche Personen verboten sind zu ehelichen. Vom ehelichen Leben, Das dritte Teil, WA 10.II 292ff.
8 WEBER I 42 Anm.1.
9 WEBER I 51ff.
10 Darauf bin ich an anderer Stelle eingegangen: s.o. unter 1.).
11 WEBER I 204f und 14.
12 Vgl. WEBER I 15. 21ff. 34 Anm.1. 53. 82. 193 Anm.2 (von 192). 200 Anm.3. 234. 197. 199. 202f. 188. 86. 128. 89. 119 Anm.1. 160-162. 218. 183. 190.
13 Gemeint sein dürfte entweder »auf der Grundlage« oder »auf Grund« der Berufsidee.
14 WEBER I 202.
15 Vgl. WEBER I 49. 83. 192 Anm.l; 205f. Häufig in WEBER II (s. Anm.17).
16 WEBER I 83. Vgl. auch 145.
17 Abgedruckt in: M.WEBER: Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken, hrsg. von J.WINCKELMANN, München und Hamburg 1968 [im folgenden abgekürzt mit WEBER II], 305. 322.
18 WEBER I 235.
19 WEBER I 195.
20 WEBER I 17-30.
21 WEBER II 317.
22 WEBER I 165 Anm.3.
23 Wobei er mit sonderbaren Alternativen arbeiten kann, wie: »Nicht die ethische Lehre einer Religion, sondern dasjenige ethische Verhalten, auf welches durch die Art und Bedingtheit ihrer Heilsgüter Prämien gesetzt sind, ist im soziologischen Sinn des Wortes ‚ihr’ spezifisches 'Ethos'« (WEBER I 234f, Hervorhebung von Weber). Als ob die religiösen »Prämien« samt der Bestimmung, auf welches »ethische Verhalten« sie bezogen sind, anders denn durch »Lehre« »gesetzt« würden!
24 WEBER I 123. Der Ausdruck »sich den Puls fühlen« wird von Weber ohne weitere Angabe in Anführungsstriche gesetzt. Darauf komme ich im übernächsten Abschnitt zurück.
25 WEBER I 203.
26 WEBER I 87.
27 Auch WEBER I 51 Anm.l und 113 Anm.l wird das im Text Behauptete durch die Erklärung, es handele sich nur um »Idealtypen«, faktisch als nicht belegbar zugestanden. Auch gegen Rachfahl meinte Weber, mit dem Verweis auf die »idealtypische« Begriffsbildung den historischen Rückfragen entkommen zu können (WEBER II 304).
28 Man achte einmal bei der Weber-Lektüre darauf, wie oft sich Weber »psychologisch« über die Träger irgendwelcher Auffassungen äußern zu können meint. Und wie erbost er reagiert, wenn seine Kritiker dasselbe tun (zB. WEBER II 31f)!
29 WEBER I 93. 103f.
30 WEBER I 143 Anm.2.
31 Auch da, wo Weber genauere Belege anzugeben scheint, müssten noch Nachprüfungen erfolgen. So ist eine für seine ganze Kombination wesentliche sprachgeschichtliche Behauptung zu »calling« (WEBER I 68f Anm.l von 65) inzwischen als haltlos nachgewiesen: Tatsuro HANYU: Max Webers Quellenbehandlung in der »Protestantischen Ethik«. Der Begriff »Calling«, ZfS 22 (1993) 65-75. – TROELTSCHS Verteidigung Webers gegen RACHFAHL (vgl. WEBER II 188-215) ist ein reiner Freundschaftsdienst: Zur historischen und sprachlichen Sache sagt Troeltsch nichts, statt dessen erklärt er Weber zum nationalökonomischen Fachmann (obwohl in den zur Debatte stehenden Aufsätzen nichts Nationalökonomisches vorkommt) und verzerrt RACHFAHLS Einwände, um sie so von Weber fernhalten zu helfen.
32 WEBER I 88 Anm.1.
33 Zitiert nach dem Wiederabdruck in: E.TROELTSCH: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, hrsg. von H.BARON, Tübingen 1925, 393.
34 WEBER I 56 Anm.l.
35 Verwiesen sei auf den bisher in seiner Wichtigkeit kaum erkannten Aufsatz von Max GEIGER: Calvin, Calvinismus, Kapitalismus, in: M.GEIGER (Hrsg.): Gottesreich und Menschenreich. Ernst STAEHELIN zum 80. Geburtstag, Basel und Stuttgart 1969, 231-286.
36 A.SCHWEIZER: Die Centraldogmen der reformierten Kirche, 2 Bde., Zürich 1854 und 1856.
37 WEBER verweist darauf I 75 Anm.2; 88 Anm.l und 105 Anm.l. Auf 147f nennt er noch einen Ergänzungsband dazu. SCHNECKENBURGER wird in TROELTSCHS o.g. RE-Artikel erwähnt, doch ohne dass er inhaltlich ausgewertet würde. Diese Vorsicht von Troeltsch halte ich für richtig.
38 SCHNECKENBURGER aa0 48. Zu Weber siehe Anm. 24. Schneckenburger verweist für die Tagebücher auf Haller und Lavater, womit er ins 18. Jahrhundert und in die Schweiz geht. Das konnte Weber nicht gebrauchen, andere reformierte Tagebuchschreiber konnte er aber offensichtlich nicht nennen.
39 SCHNECKENBURGER aa0 38ff. Der Ausdruck »Selbstgewissheit« auch bei Weber (zB. I 105).
40 SCHNECKENBURGER aa0 69. Daher wird Weber das Recht abgeleitet haben, sich auch auf Spener zu berufen, obwohl er ungeklärt ließ, ob Spener stärker angeblich reformierte Auffassung teilt (so 1910 gegenüber Rachfahl) oder stärker von ihr abweicht (so in den Fußnoten von 1904/05).
41 Vgl. die prinzipielle Erklärung, 16: »Hienach ist unsere Aufgabe die, eine in’s Einzelne gehende Nachweisung der Differenzen zu geben, welche in der ursprünglichen Auffassung des religiösen Inhalts zwischen beiden Confessionen liegen, um diese Verschiedenheit auf psychologische Gesetze zu reduzieren und daraus zu begreifen. Dadurch wird unser Geschäft irenisch.« Vgl. auch 36 und dann die Einzelausführungen.
42 Wie Weber zufrieden feststellte (WEBER II 345).
43 Aa0 39.
44 Ich zitiere die Bestimmung aus dem Christianae Theologiae Compendium von Joh. WOLLEB (1626): »Bei der Erforschung unserer Erwählung sollen wir nach analytischer Methode von den Mitteln der Ausführung zum Ratschluss vorwärts gehen und den Anfang nehmen bei unserer Heiligung. Und zwar nach folgendem Syllogismus: Wer in sich die Gabe der Heiligung, dadurch wir der Sünde sterben und der Gerechtigkeit leben, wahrnimmt (sentit), der ist gerechtfertigt, berufen oder mit dem wahren Glauben beschenkt und erwählt. Aber durch Gottes Gnade nehme ich das wahr (sentio). Mithin (ergo) bin ich gerechtfertigt, berufen und erwählt.« (Lib. 1, Cap. IV, § 2, XV. Neudruck hrsg. von E.BIZER, Neukirchen 1935, 24. Übersetzung von E.HIRSCH: Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, 4. Aufl. Berlin 1964, 400f).
45 WA 10/I 4421 (Modernisierung der Schreibweise nach der Münchner Ausgabe, Ergänzungsband 4, 35).
46 Aa0 452.
47 Aa0 4428.
48 Es ist die Lehre von den »signa praedestinationis«, jener im Leben erfahrbaren Zeichen, aufgrund derer der Mensch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seine Prädestination erhoffen durfte. Darauf machte mich Herr Kollege Manfred SCHULZE aufmerksam, und er war freundlicherweise bereit, erläuterndes Material für diesen Band beizusteuern. S.102-106.
49 BSLK 68431-68537.
50 BSLK 21452: »Ut igitur baptismus, ut coena Domini sunt signa, quae subinde admonent, erigunt et confirmant pavidas mentes, ut credant firmius remitti peccata: ita scripta et picta est eadem promissio in bonis operibus, ut haec opera admoneant nos, ut firmius credamus. Et qui non benefaciunt, non excitant se ad credendum, sed contemnunt promissiones illas. Sed pii amplectuntur eas et gaudent habere signa et testimonia tantae promissionis. Ideo exercent se in illis signis et testimoniis.« Vgl. den ganzen Abschnitt ab 21430. Die deutsche Übersetzung von Justus Jonas dazu ist ziemlich frei: 21315-35.
51 M.Lutherus: Primus tomus Enarrationum in Epistolas & Euangelia etc., Argentorati 1525, mit Vorrede von M.Bucer (siehe R.STUPPERICH: Bibliographia Bucerana, Gütersloh 1952, Nr.10), p.38A. Ob sich für Melanchthon von daher aa0. »testimonia« als Wechselbegriff zu »signa« nahelegte?
52 BSLK ebd.; zur Geschichte der lateinischen Übersetzung vgl. dort XXIX. A.LANG (Die Quellen der Institutio von 1536, EvTh 3 [1936] 109) geht auch hinsichtlich der Auslegung der 5. Vaterunserbitte auf das Verhältnis Bucer-Calvin ein, übersieht aber die Abhängigkeit beider von Luther.
53 Inst III,14,20: »non aliter quam vocationis signa unde electionem reputent« (OS IV 23810). Die Reihenfolge von »vocatio« und »electio« zeigt, daß hier 2.Petr 1,10 mitschwingt.
54 CO 55, 449f.
55 Im Heidelberger allerdings erst in späterer Korrektur von 1.Petr l,6f.
56 A.LANG: Der Heidelberger Katechismus und vier verwandte Katechismen. Mit einer historisch-theologischen Einleitung, Leipzig 1907, reprogr. Nachdruck Darmstadt 1967, 80: der Text von Leo Jud, vgl. XCIV zur Erklärung. Im Heidelberger Katechismus: Fr. 86, oft gedruckt.
57 Der 1. Katechismus: OS I 409; die lat. Fassung CO 33,348; der französische Text des 2. Katechismus: W.NIESEL (Hrsg.): Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche, 2.Aufl. Zollikon-Zürich 1938, 32 (Frage 285); der lateinische Text: MÜLLER aa0 143f und OS II 125.
58 MÜLLER 57428.
59 MÜLLER 552, Abschnitt 8 von Kap. III. Man achte auch hier auf den vorsichtigen Komparativ.
60 MÜLLER 845.
61 De certitudine gratiae et salutis / Of Assurance of Grace and Salvation. Weber erwähnt die Stelle unter dem Gesichtspunkt der erreichbaren Grade der Gewissheit (WEBER I 104, Anm. 1).
62 MÜLLER 579f. Der Ausdruck »gutes Gewissen« für den Wandel in der Heiligung ist von 1.Petr 3,16 abhängig und findet sich auch in den Dordrechter Canones V,10 (MÜLLER 8589) und zu Beginn von Calvins schon genannter Auslegung von 2.Petr 1,10 (CO 55,449).
63 Vgl. dieselbe Sicherstellung in der Conclusio bei WOLLEB, s.o. Anm.44.
64 A.SCHWEIZER: Centraldogmen, 2. Hälfte, 20.
65 A.SCHWEIZER: Centraldogmen, 1. Hälfte, 582f.
66 Aa0 577.
67 A.SCHWEIZER: Centraldogmen, 2. Hälfte, VIII. Vgl. auch u. Anm.73 und bei WOLLEB den (auf die in Anm.44 zitierte Stelle folgenden) Abschn. XVI. - In diesem Sinne sind wohl die einschlägigen Stellen der Beschlüsse der Dordrechter Synode 1618/19 zu verstehen (I,12; V,10 mit der Reiectio errorum V,5: MÜLLER 845. 858 und 860). Die letzte Stelle zeigt: Man hatte sich dort gleichzeitig gegen die Behauptung abzusetzen, es gebe keine wirkliche Erwählungsgewissheit außer durch spezielle Gottesoffenbarung. Dem stellte die Synode die Genugsamkeit der Christusverheißung entgegen und setzte hinzu (zwei Fliegen mit einer Klappe schlagend): Ferner (denique) gebe es Gewissheit aus einem ernstlichen und heiligen Streben nach einem guten Gewissen und nach guten Werken. Theologisch anzukreiden bleibt diesen Stellen, dass nur in der Reiectio errorum V,5 der Zeichenbegriff auftaucht (MÜLLER 86023). Dafür passiert da das Unglück, dass die signa vor der Verheißung Gottes genannt werden.
68 BARTH: Calvin 371f.
69 BARTH: Calvin 240. 243. 249f.
70 Hier ist das Wort »probatio« aus Butzers Übersetzung der einschlägigen Stelle von Luthers Wartburgpostille übernommen. Mit »probare« und »testari« gibt Butzer (aa0.) Luthers Ausdruck wieder, dass die Liebe den Glauben »beweist und bewährt«. Der von Max Weber so geliebte Ausdruck »Bewährung« müsste also als probatio/probare (proof/to prove) im Sinne des Beweises verstanden werden, womit theologie- und frömmigkeitsgeschichtlich aber nicht mehr zu holen ist, als ich hier angeführt habe.
71 CO 55,311.
72 Die besondere Stellung der Heiligung bei Calvin hat BARTH in KD IV/2 567–578 (§66,1) diskutiert.
73 CO 55,450. Mit der Fortsetzung: Unde palam fit, quam indigne Deo oblatrent (anbellen) impuri quidam canes, dum gratuitam eius electionem praetextum faciunt omnis licentiae, quasi vero impune ideo peccare fas sit, quia ad iustitiam et sanctitatem praedestinati sumus.
74 BARTH: Calvin 372f.
Vom Autor Dieter Schellong für die online-Veröffentlichung auf www.reformiert-info.de überarbeitete Fassung seines Beitrags in: Karl Barth und Johannes Calvin. Karl Barths Göttinger Calvin-Vorlesung von 1922, hrsg. von Hans Scholl, Neukirchen-Vluyn 1995, 74–101.
Zitierempfehlung für die online Version des Textes:
Dieter Schellong, Calvinismus und Kapitalismus. Anmerkungen zur Prädestinationslehre Calvins (2008), online auf reformiert-info.de, URL: http://www.reformiert-info.de/2851-0-105-16.html (Abrufdatum), überarbeitete Fassung des gleichnamigen Beitrags in: Karl Barth und Johannes Calvin. Karl Barths Göttinger Calvin-Vorlesung von 1922, hrsg. von Hans Scholl, Neukirchen-Vluyn 1995, 74–101.
Prof. Dr. Dieter Schellong, Münster
Dieter Schellong, Calvinismus und Kapitalismus. Anmerkungen zur Prädestinationslehre Calvins.pdf